 Der Wunsch, den gesichtsentstellenden Augenverlust beim Menschen zu kaschieren, ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Seit 150 Jahren versucht die Augenprothetik, ihn zu erfüllen – erst als Handwerk, heute als Heilhilfsmittelberuf.
Der Wunsch, den gesichtsentstellenden Augenverlust beim Menschen zu kaschieren, ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Seit 150 Jahren versucht die Augenprothetik, ihn zu erfüllen – erst als Handwerk, heute als Heilhilfsmittelberuf.Die Hoffnung auf ein besseres Leben lagert in einem unscheinbaren Metallschrank. Jede Schublade ist ordentlich beschriftet: Blau-Grau, Hasel-Braun, gelber Stern. Vorsichtig öffnet Marc Trester eine der Schubladen. Man blickt in Hunderte Augen. Filigrane Glaskugeln, jede mit einer andersfarbigen Iris. Trester deutet auf eine: „Dieser schmale gelbliche Ring um die Pupille, das nennt sich ‚gelber Stern‘.“ Für ihn ist ein Auge nicht nur blau, grün oder braun, jedes ist individuell. Es ist Tresters Job, dieses Einzigartige direkt zu erkennen: Er fertigt Prothesen für Menschen an, die durch eine Verletzung, eine Krankheit oder einen Gendefekt ein Auge verloren haben. Die Glaskugeln sind Rohlinge.
Kunstaugenmacher, Augenkünstler oder Glasaugenbläser – für Tresters Beruf gab es über die Jahre viele Bezeichnungen. Inzwischen hat sich Ocularist etabliert. Nur rund 70 davon gibt es in Deutschland. Der Großteil arbeitet in Familienbetrieben, die teils auf eine über hundertjährige Geschichte zurückblicken. Auch das 1923 gegründete Institut für Augenprothetik W. Trester ist ein solches Traditionsunternehmen. Marc Trester führt bereits in dritter Generation die rheinische Augenprothetik fort.
 Anfangs gilt die Herstellung von Kunstaugen noch vornehmlich als Handwerk. Doch das ändert sich, als Ludwig Müller-Uri 1835 neue Techniken der Herstellung entwickelt und so zum Begründer der später dominierenden deutschen Ocularistik wird. Der medizinische Anteil an der Arbeit wächst und rückt immer stärker in den Fokus. Heutzutage arbeiten Ocularisten im Hilfsmittelbereich. Sauberkeit und hohe Hygienestandards sind Pflicht. In der sechsjährigen Ausbildung wird auch ein fundiertes medizinisches Grundwissen über das Auge vermittelt: Anatomie, Krankheitsbilder, Operationstechniken. Selbstverständlich für Trester: „Nur wenn ich weiß, welches Implantat ein Chirurg eingesetzt hat oder wie sich eine Krankheit auf die Augenhöhle auswirkt – was also möglich und machbar bei meinem Patienten ist –, kann ich einfühlsam beraten und am Ende die perfekte Prothese herstellen.“ Einmal perfekt bedeutet zudem nicht immer perfekt. Denn mit der Zeit kann sich die Beschaffenheit der Augenhöhle verändern. Hinzu kommt die natürliche Abnutzung der Prothese. Mindestens einmal im Jahr muss der Patient daher im Institut zur Neuanpassung erscheinen. Treten anatomische Veränderungen ein, steht Marc Trester in engem Austausch mit den behandelnden Ärzten. Ocularist und Arzt begegnen sich dabei auf Augenhöhe: „Erst wenn wir gemeinsam die Sorgen, Nöte und Ängste des Patienten in unsere Arbeit und Beratung einbeziehen, gewährleisten wir ein Höchstmaß an Rehabilitation.“ Denn bei der wiederhergestellten Ästhetik geht es auch darum, den traumatisierten Patienten wieder in sein gewohntes soziales Leben zurückzuführen.
Anfangs gilt die Herstellung von Kunstaugen noch vornehmlich als Handwerk. Doch das ändert sich, als Ludwig Müller-Uri 1835 neue Techniken der Herstellung entwickelt und so zum Begründer der später dominierenden deutschen Ocularistik wird. Der medizinische Anteil an der Arbeit wächst und rückt immer stärker in den Fokus. Heutzutage arbeiten Ocularisten im Hilfsmittelbereich. Sauberkeit und hohe Hygienestandards sind Pflicht. In der sechsjährigen Ausbildung wird auch ein fundiertes medizinisches Grundwissen über das Auge vermittelt: Anatomie, Krankheitsbilder, Operationstechniken. Selbstverständlich für Trester: „Nur wenn ich weiß, welches Implantat ein Chirurg eingesetzt hat oder wie sich eine Krankheit auf die Augenhöhle auswirkt – was also möglich und machbar bei meinem Patienten ist –, kann ich einfühlsam beraten und am Ende die perfekte Prothese herstellen.“ Einmal perfekt bedeutet zudem nicht immer perfekt. Denn mit der Zeit kann sich die Beschaffenheit der Augenhöhle verändern. Hinzu kommt die natürliche Abnutzung der Prothese. Mindestens einmal im Jahr muss der Patient daher im Institut zur Neuanpassung erscheinen. Treten anatomische Veränderungen ein, steht Marc Trester in engem Austausch mit den behandelnden Ärzten. Ocularist und Arzt begegnen sich dabei auf Augenhöhe: „Erst wenn wir gemeinsam die Sorgen, Nöte und Ängste des Patienten in unsere Arbeit und Beratung einbeziehen, gewährleisten wir ein Höchstmaß an Rehabilitation.“ Denn bei der wiederhergestellten Ästhetik geht es auch darum, den traumatisierten Patienten wieder in sein gewohntes soziales Leben zurückzuführen.
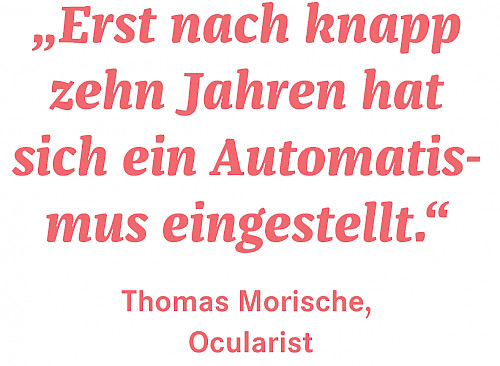 Aber wie sieht eine Augenprothese aus Glas überhaupt aus? „Das hängt von der Beschaffenheit der Augenhöhle ab“, erklärt Trester. Wird einem Patienten operativ das Auge entfernt, kommt an die Stelle des Augapfels in der Regel ein kugelförmiges Implantat, das dann mit dem noch erhaltenen Gewebe verwächst. Zwischen Implantat und Augenlidern bleibt Platz für die Prothese – mal mehr, mal weniger. So gibt es dünne einwandige Prothesen oder auch dickere doppelwandige. Sie gleichen kleinen Muschelschalen. Manche sind kaum größer als die Iris, andere groß wie ein 50-Cent-Stück. „Was am besten passt, entscheide ich intuitiv nach Erfahrungswert. Da gibt es keine Messinstrumente“, so Trester. Zwei Wochen nach der OP bekommt der Patient zunächst ein vorläufiges Modell – zur Gewöhnung und um den Heilungsprozess zu begleiten. Nach weiteren zwei bis drei Wochen erscheint der Patient erneut im Institut. Dann wird der passende Glasrohling mit der gezeichneten Iris für die endgültige Prothese individuell ausgesucht. Anschließend folgt der kunsthandwerkliche Teil der Arbeit.
Aber wie sieht eine Augenprothese aus Glas überhaupt aus? „Das hängt von der Beschaffenheit der Augenhöhle ab“, erklärt Trester. Wird einem Patienten operativ das Auge entfernt, kommt an die Stelle des Augapfels in der Regel ein kugelförmiges Implantat, das dann mit dem noch erhaltenen Gewebe verwächst. Zwischen Implantat und Augenlidern bleibt Platz für die Prothese – mal mehr, mal weniger. So gibt es dünne einwandige Prothesen oder auch dickere doppelwandige. Sie gleichen kleinen Muschelschalen. Manche sind kaum größer als die Iris, andere groß wie ein 50-Cent-Stück. „Was am besten passt, entscheide ich intuitiv nach Erfahrungswert. Da gibt es keine Messinstrumente“, so Trester. Zwei Wochen nach der OP bekommt der Patient zunächst ein vorläufiges Modell – zur Gewöhnung und um den Heilungsprozess zu begleiten. Nach weiteren zwei bis drei Wochen erscheint der Patient erneut im Institut. Dann wird der passende Glasrohling mit der gezeichneten Iris für die endgültige Prothese individuell ausgesucht. Anschließend folgt der kunsthandwerkliche Teil der Arbeit.
 Jedes Kunstauge wird nach wie vor nach Augenmaß angepasst und mundgeblasen. Während weltweit inzwischen vornehmlich Acrylaugen produziert werden, setzt man in Deutschland weiterhin auf Glas: Es ist glatter, härter, leichter und verträglicher. In der Augenprothetik ist „Made in Germany“ damit ein Qualitätssiegel. Viele deutsche Ocularisten sind daher regelmäßig im Ausland unterwegs. Auch Tresters Vorfahren haben schon in Amerika, Afrika und Europa gearbeitet.
Jedes Kunstauge wird nach wie vor nach Augenmaß angepasst und mundgeblasen. Während weltweit inzwischen vornehmlich Acrylaugen produziert werden, setzt man in Deutschland weiterhin auf Glas: Es ist glatter, härter, leichter und verträglicher. In der Augenprothetik ist „Made in Germany“ damit ein Qualitätssiegel. Viele deutsche Ocularisten sind daher regelmäßig im Ausland unterwegs. Auch Tresters Vorfahren haben schon in Amerika, Afrika und Europa gearbeitet.
Mit einem Zischen strömt Gas aus dem Bunsenbrenner. Thomas Morische zündet es an. Die Flamme ist fast durchsichtig. Bis zu 1.000 Grad Celsius braucht es, um aus dem Rohling ein Kunstauge zu machen. Tresters Mitarbeiter hält die Glaskugel ins Feuer, dreht sie langsam und gleichmäßig. Wo die Flamme auf das Glas trifft, flackert sie orange. Das Glas wird heiß, schmilzt, verformt sich. Dann bläst Morische vorsichtig Luft in die Kugel. Die Schalenform der Prothese entsteht durch Einschneiden mit der Flamme. 20 Minuten dauert das Ganze. Was für Morische heute Routine ist, hat ihn viel Übung gekostet – und viele Nerven. „Eigentlich hat sich erst nach knapp zehn Jahren ein Automatismus eingestellt“, sagt der 38-Jährige, der seit 14 Jahren als Ocularist im Institut Trester tätig ist, „abends war ich anfangs immer völlig erledigt.“ Jetzt findet er die Arbeit meditativ. So wie wohl auch viele seiner Patienten, die bei der Fertigung der Prothese in der Regel neben ihm sitzen. „Die älteren Semester nicken auch mal ein, wenn sie mir zuschauen“, erzählt Morische lachend.

Dass die Patienten dabei sind, wenn ihr Glasauge gefertigt wird, ist nicht überall üblich. Marc Trester aber ist das wichtig. „Die Augen sind oft das Erste, auf das wir bei anderen achten. Ein Auge zu verlieren ist meist ein traumatisches Erlebnis“, erklärt er. Einfühlungsvermögen sei für einen Ocularisten daher unabdingbar. Jeder Patient habe seine persönliche Leidensgeschichte. Oft würden die Leute anfangs nicht darüber reden wollen, aber bei der Anfertigung der Prothese entwickele sich dann doch noch ein Gespräch – und das sei für viele letztlich sehr befreiend. Erst vor kurzem habe er das bei einer Patientin wieder erlebt, sagt Trester: „Im ersten Termin sagte sie, das Auge habe sie durch einen Unfall verloren. Erst nach einigen Behandlungen hat sie mir offenbart: ‚Es war kein Unfall, es war im Konflikt mit meinem Mann.‘ Danach war sie viel entspannter.“
Das Augenlicht können Institutsinhaber Trester und sein Team ihren Patienten nicht zurückgeben, häufig aber einen Teil ihres Selbstwertgefühls. Einer der schönsten Momente seiner Arbeit, sagt Thomas Morische, sei daher, wenn der Patient sich zum ersten Mal mit seiner ersten Augenprothese im Spiegel sieht: „Da fließen schon mal Freudentränen.“ Für viele bedeutet das Kunstauge ein besseres Leben, eine Rückkehr zur Normalität. Denn eine gute Augenprothese lässt sich im Alltag oft schwer erahnen. Sie bewegt sich meist wie ein natürliches Auge und hat eine natürliche Anmutung. Nur ihre starre Pupillengröße verrät sie. Doch selbst Trester sagt, in vielen Fällen könne er ein Kunstauge erst erkennen, wenn er sehr genau hinschaue. Bei manchen seiner Patienten wisse nicht einmal der Ehepartner von der Prothese. „Dass man ihnen wieder tief in beide Augen schauen kann, ist das schönste Geschenk, das wir unseren Patienten machen können“, sagt der Ocularist.