Professor Dr. Gabriele Kaczmarczyks Reaktion auf die Worte der Patientin waren eindeutig: „Ich habe gedacht, die spinnt.“ Die Patientin nämlich behauptete gegenüber der Anästhesistin, sie habe den Rest der Operation noch mitbekommen. Kaczmarczyk glaubte das nicht – auch nicht, als andere Patientinnen Ähnliches berichteten. Erst als ihr eine Studie aus den USA in die Hände fällt, ändert sie ihre Meinung. Die besagte: Frauen erwachen bei gleicher Dosierung des gleichen Anästhetikums schneller aus der Narkose als Männer. 25 Jahre ist das her. Es war der Moment, in dem Gabriele Kaczmarczyk aus einem Gerechtigkeitsgefühl heraus beschließt, sich der Gendermedizin zuzuwenden. Diese widmet sich als Forschungsfeld den wichtigsten biologischen Unterschieden zwischen Männern und Frauen im Hinblick auf die Folgen für die Medizin. „So wie die Geriatrie auf das ‚Alter‘ des Patienten als Einflussfaktor auf seine Gesundheit und bestimmte Krankheitsverläufe schaut, schaut die Gendermedizin auf den Faktor ‚Geschlecht‘“, erklärt die Vizepräsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes und Beirätin der Deutschen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin (DGesGM).
Die Liste der Dinge, die durch das Geschlecht beeinflusst werden, ist lang: Krankheiten äußern sich mit anderen Symptomen, manche Erkrankungen treten bei einem Geschlecht gar nicht erst auf, Medikamente wirken anders oder bleiben komplett wirkungslos. Diese Unterschiede zu ignorieren, kann lebensgefährlich werden – vor allem für Frauen. „Das bekannteste Beispiel ist der Herzinfarkt“, sagt Kaczmarczyk, „er bleibt immer noch oft unentdeckt, weil Frauen ‚unspezifischere‘ Symptome haben können wie beispielsweise Schmerzen im Oberbauch oder Übelkeit.“ Besonders problematisch ist auch die unterschiedliche Reaktion auf Medikamente. 1997 wird in einer großen US-Studie die Wirksamkeit des Herzinsuffizienzmittels Digoxin belegt. Fünf Jahre später analysiert einer der Autoren die Studie erneut – mit Blick auf die Wirksamkeit jeweils bei Männern und Frauen. Das Ergebnis: Männer profitieren von Digoxin, Frauen aber nicht. Sowas ist, laut Kaczmarczyk, vermutlich kein Einzelfall.
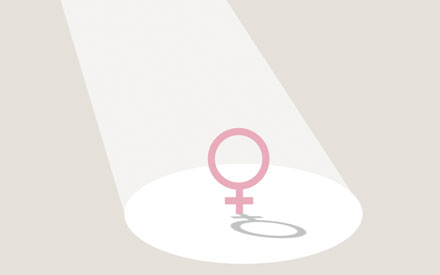 MIT DER FORSCHUNG FÄNGT ES AN
MIT DER FORSCHUNG FÄNGT ES AN
„Die Forschung hat immer so getan, als gäbe es keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern“, erklärt Prof. Dr. Vera Regitz-Zagrosek. Die Kardiologin gilt als deutsche Pionierin der Gendermedizin. 2003 besetzte sie die deutschlandweit erste Professur für Frauenspezifische Gesundheitsforschung, 2007 rief sie die DGesGM ins Leben und baute an der Berliner Charité das Institut für Geschlechterforschung in der Medizin auf, das sie bis letztes Jahr leitete. Das Problem fängt schon bei den Tierversuchen an, so Regitz-Zagrosek: „Viele Forscher experimentieren fast ausschließlich mit männlichen Mäusen. Bei Weibchen befürchtet man, ihr Zyklus könnte zu einer stärkeren Streuung der Versuchsergebnisse führen.“ Wenn die Studien in die klinische Phase gehen, setze sich dieser Trend fort. In den frühen Phasen werden vor allem junge Männer untersucht und an ihnen die Dosierungen erarbeitet. Auch in den späteren Studien zur Wirksamkeit machen Frauen nicht selten nur ein Fünftel der Probanden aus. In nur 15 Prozent der Arzneimittelstudien werden die Nebenwirkungen geschlechtsspezifisch berichtet. Dabei treten diese bei Frauen nachweislich anderthalbmal häufiger auf. „Wir haben all diese Vorschriften in Europa, dass Frauen gleichermaßen in Studien einbezogen werden oder dass an Studien nach Geschlechtern getrennt auswerten soll. Aber das sind nur Soll-Vorschriften, keine Muss-Vorschriften“, so Regitz-Zagrosek. Sie wünscht sich hier mehr Verbindlichkeit. Doch Gendermedizin bleibt ein Nischenthema. Das Institut für geschlechtsspezifische Forschung der Berliner Charité ist bis heute das einzige seiner Art in Deutschland.
EIN REINES FRAUENTHEMA?
Woran liegt das? Bequemlichkeit, meint Regitz-Zagrosek. Gabriele Kaczmarczyk sieht noch einen anderen Grund: „Gendermedizin kommt aus der ‚Frauenecke‘.“ Männer hätten das Thema lange nicht ernst genommen – und sie besetzen immer noch den Großteil der Führungspositionen in der Medizin. Paradox: Selbst der Präsident der Internationalen Gesellschaft für Gendermedizin war in den letzten vier Jahren ein Mann – obwohl die Mitglieder zu 90 Prozent weiblich sind. Erst langsam findet in der Medizin ein Umdenken statt. „Inzwischen interessieren sich durchaus immer mehr Männer für die Gendermedizin, weil es einfach ein neues, spannendes Forschungsfeld ist und ihnen auch bewusst wird: Gendermedizin hilft allen, nicht nur den Frauen“, so Kaczmarczyk. „Unser Ziel als Ärzte und Ärztinnen ist die personalisierte Medizin – das fängt beim Geschlecht an.“ Was fehle – das betonen beide Medizinerinnen – sei die feste Einbindung der Gendermedizin in die studentische Lehre. Laut einer Umfrage des Deutschen Ärztinnenbundes von 2016 wurde in weit über der Hälfte der Medizinfakultäten „Gendermedizin“ nicht im Lehrplan thematisiert. Eine Folgeumfrage unter Medizinstudentinnen von 2020 zeigt: Immer noch ist bei rund 70 Prozent der Befragten das Thema im Studium nicht präsent. Doch viele Studierende wollen das ändern. „Ich habe festgestellt, die jungen Mediziner und Medizinerinnen sind von dem Thema schon infiziert, wüssten gerne mehr dazu – viele organisieren auf eigene Faust Veranstaltungen zur Gendermedizin“, sagt Kaczmarczyk. Für sie ist klar: „Meine Hoffnung sind die Jungen. Die wollen es besser machen!“
Interview
 „ICH THERAPIERE GEZIELTER“
„ICH THERAPIERE GEZIELTER“Wieso haben Sie sich als Gendermedizinerin zertifizieren lassen?
Vor etwa 15 Jahren hatten wir oft Patientinnen, die vorher von Arzt zu Arzt geschickt wurden – ohne dass eine Diagnose gestellt werden konnte. Der Grund: Das Wissen um geschlechterspezifische Unterschiede bei Krankheiten war zum damaligen Zeitpunkt nur schwach ausgeprägt. Die Ursache der Beschwerden konnte dann erst verzögert erkannt werden. Das hat mich sensibilisiert, dass wir Ärzte diese grundlegenden Geschlechterdifferenzen in jeder Behandlung mitdenken müssen.
Was bedeutet diese Zusatzqualifikation für Ihren Praxisalltag?
Frauen haben häufiger arzneimittelbedingte Nebenwirkungen. Auch bei Belastungs-EKGs kommt es oft zu falschen Werten. Diese Besonderheiten berücksichtige ich bei Verschreibungen beziehungsweise sichere Ergebnisse durch eine zweite Untersuchung ab.
Sie haben die Zusatzqualifikation 2011 erworben, was hat sich seitdem getan?
Das Thema ist bei uns Ärzten, aber auch bei Patienten in den letzten Jahren stärker in den Fokus gerückt. Leider ist die Zusatzbezeichnung „Gendermediziner“ noch nicht in den Weiterbildungskatalog der Ärztekammern aufgenommen worden. Es wäre schön, wenn die Gesundheitspolitik das Thema stärker fördern würde.
Informationen zur Zusatzqualifikation „Gendermediziner/in“ unter www.dgesgm.de/zusatzbezeichnung-gendermediziner.html